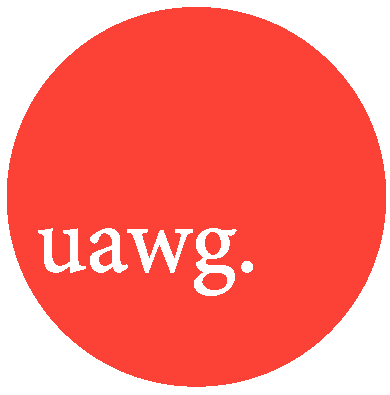Glück und Glas, wie leicht bricht das – sagt ein altes Sprichwort - und doch umgeben wir uns permanent mit dem fragilen Werkstoff. Ich will wissen, was es mit Glück, Sand und Glas auf sich hat und konsultiere die WIEN PRODUCTS Homepage www.wienproducts.at. Dann mache ich mich auf in den 10. Bezirk, wo in der Pernersdorfergasse die Werkstatt der Fritz Spatny Edition zu finden ist.
Dass man mit Sand Glas strahlen und so Muster und Motive auf das Material bringen kann, weiß man schon lange. In Wien gab es viele Glasereien, die das Handwerk beherrschten, erzählt mir der Chef Michael Müllner, als er mit mir die Werkstatt durchschreitet. Sein Großvater Fritz Spatny gründete 1931 sein Unternehmen im 5. Bezirk. Damals gab es ja noch viel mehr Glas in den typischen Wiener Wohnungen mit hohen Räumen und Flügeltüren und das wollte aufwändig gestaltet sein!.
Greift man heute oft zur billigeren Folie, um Glas undurchsichtig zu machen oder Motive aufzubringen, ist die Sandstrahltechnik um Einiges raffinierter.
Wir stehen am großen Arbeitstisch und die Handwerker sind gerade in ihrem Element. Ich bekomme praktisch live eine Einführung in die Kunst des Sandstrahlens.... Zuerst wird einmal festgelegt, was durchsichtig und was gestrahlt werden soll. Man kann den Positiv-Negativ Effekt selbst bestimmen – manchmal ist das Motiv sandgestrahlt und manchmal der Rest.
Man braucht eine ruhige Hand, um die Vorlagen auf Pergamentpapier zu übertragen und später mittels Folie auf das Glas zu bringen. Vor allem, wenn es um unterschiedliche Schattierungen geht, die man selbst bei komplexen Bildmotiven anbietet – sind Geduld und klares Vorgehen wichtig.
Ich schaue zu, wie ein Motiv aus der gelben Folie, die das gesamte Glas bedeckt, mit einem scharfen Skalpell vorsichtig Stück für Stück freigelegt wird. Diese Flächen werden später mit winzigkleinen Sandkörnern und einer großen Geschwindigkeit „beschossen“ und machen die Oberfläche des Glases undurchsichtig, rauen sie praktisch auf.
Möchte man eine noch bessere Tiefenwirkung erreichen, werden die Motive in Etappen aus der Folie geschnitten - der wiederholte Vorgang des Sandstrahlens verstärkt bei jedem Durchgang die Wirkung – so erhält man fast einen 3D Effekt.
Ich bin begeistert. Gerade trägt ein Kollege die Glasscheibe in den Teil der Werkstatt, wo das Sandstrahlgerät steht. Ich darf ausnahmsweise zuschauen. Die Scheibe wird sorgfältig auf einer Ablage platziert und der Mitarbeiter verschwindet hinter einem durchsichtigen und teilweise beweglichen Vorhang. Nun beginnt der Sandstrahlprozess. Aus einem Druckluftschlauch – der Anblick erinnert mich an einen Feuerwehrschlauch – wird nun Sand mit einer definierten Körnung unter hohem Druck auf die Scheibe „gestrahlt“. Dabei ist es wichtig, dass der Handwerker den „Sandstrahl“ sehr gleichmäßig und ruhig über die Scheibe führt – nichts auslässt aber auch nichts doppelt bestrahlt.
Fertig. Jetzt wird die Scheibe behutsam wieder zurück auf den großen Arbeitstisch gelegt und das Ganze genau geprüft. Hier ist man mit Adleraugen am Werk! Wenn alles passt, wird die Folie sehr vorsichtig vom Glas entfernt – auch eine Arbeit für Geduldige.
Nach einiger Zeit liegt das fertige Stück vor uns – tolle Arbeit! Mich interessiert natürlich, wer hier so alles Glas auf diese Weise verschönern lässt. Die beiden Handwerker lachen – und erzählen mir, dass es neben Privatkunden natürlich auch Öffentliche Einrichtungen wie Theater oder Ähnliches sind, wo zum Beispiel Scheiben von Schwingtüren zu Bruch gehen und diese hier in Favoriten neu gefertigt werden. Gerade in den alten typischen Wiener Wohnungen mit hohen Räumen und Flügeltüren en masse besteht immer wieder Nachfrage nach den Scheiben. Manche von ihnen sind beschädigt, andere zu Bruch gegangen – in jedem Fall sind die Bewohner dieser Wohnungen froh, wenn sie die richtigen Partner zur Lösung ihres Problems finden. Glück im doppelten Sinne.
Und dann gibt es Kunden, die Extravagantes lieben und sich – passend zu ihren Möbelstoffen – zum Beispiel Tischplatten oder Spiegelelemente anfertigen lassen, die vor allem mit Hinterleuchtung einen ganz reizvollen Effekt im Raum haben.
Die Mitarbeiter der Edition Fritz Spatny sind künstlerisch sehr begabt und flexibel in ihrem Tun. Auch ganz moderne Entwürfe, Schriftzüge, Logos und so weiter werden hier umgesetzt. Nicht nur auf Glas, sondern auch Holz, Stein, Kunststoff lassen sich so bearbeiten und individuell gestalten.
In Wien gibt es eine ganze Menge Anwendungen im öffentlichen und privaten Bereich, die hier in der Werkstatt entstanden sind. Sogar Trinkgläser erhielten schon mittels Sandstrahltechnik eine interessante Oberfläche.
Man spürt, dass die Handwerker ihr Metier verstehen und mit Leidenschaft ihrer Arbeit nachgehen. Als ich – beeindruckt vom Erfahrenen – die Werkstatträume verlasse und durch die Stadt spaziere, fallen mir an vielen Stellen plötzlich besonders gestaltetet Glasscheiben ins Auge. Ich bin mir sicher – nicht nur für mich ist die besondere Qualität der Fritz Spatny Edition einen Spaziergang nach Favoriten wert.
Dieser Blogbeitrag entstand im Auftrag der WIEN PRODUCTS. www.wienproducts.at